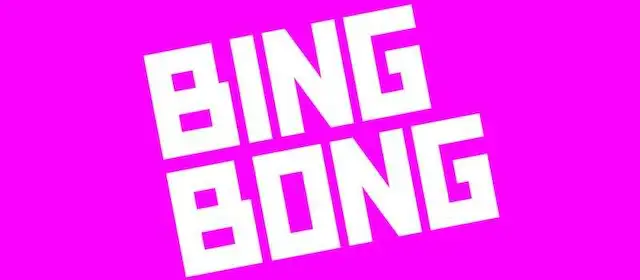Stefanie Drese drängt nach der Gamescom auf klare Regeln für Lootboxen.
Auf der Gamescom in Köln hat Mecklenburg-Vorpommerns Jugend- und Gesundheitsministerin Stefanie Drese intensive Gespräche mit Branchenvertretern, Expertinnen und Experten sowie Spielerinnen und Spielern geführt. Im Fokus standen Lootboxen, Suchtprävention und Jugendschutz.
Nutzungsmuster Jugendlicher: Hohe Reichweiten, viel Kontakt zu Lootboxen
Ihre Einschätzung ist eindeutig: „Der Handlungsbedarf ist groß.“ Die politisch Verantwortliche verortet die Debatte ausdrücklich im Spannungsfeld von Spielspaß, Wirtschaftskraft und Glücksspiel-Risiken. Die Ministerin verweist auf die Alltagstauglichkeit digitaler Spiele:
„Rund 72 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 12–19 Jahren [spielen] mehrmals die Woche oder sogar täglich.“
Werktags verbringen sie im Durchschnitt 90 Minuten mit Gaming, an Wochenenden rund drei Stunden. In dieser Nutzungsdichte begegnen Jugendliche häufig Bezahlmechaniken, die das Fortkommen beschleunigen oder exklusive Inhalte freischalten – ein Einfallstor für Glücksspiel-ähnliche Anreize.
Zufallsbasierte Truhen: Wie Lootboxen funktionieren
Lootboxen bieten zufallsbasierte Inhalte, die reale Vorteile im Spiel versprechen. Der Zugang erfolgt über Zahlungen mit echtem Geld – direkt per In-App-Kauf oder via interne Spielwährung. Die zentrale Kritik von Drese:
„Die Spielerinnen und Spieler wissen beim Kauf nicht, was sie für ihr Geld erhalten.“
Gerade die Aussicht auf „besondere Raritäten“ oder das Freischalten spezieller Charaktere führe dazu, „dass die Lootboxen immer wieder zum Einsatz von echtem Geld verleiten“. Aus ihrer Sicht „ähnelt das Prinzip stark den Mechanismen des Glücksspiels“.
Ökonomische Dynamik und Schutzinteressen: Ein Spannungsfeld
Für die Branche sind Lootboxen eine relevante Erlösquelle – nach Einschätzung Dreses reicht der Anteil in manchen Modellen „bis nahezu an die Hälfte“ des Umsatzes heran. In der Jugendschutzperspektive stehen dem jedoch erhebliche Risiken gegenüber:
„Jugendliche könnten in Abhängigkeiten geraten oder sich finanziell in Schwierigkeiten begeben bis hin zur Überschuldung“.
Die Glücksspielsucht bildet dabei einen besonders sensiblen Problembereich. Eine Studie der Universität Graz (2024) zeigt, dass über 40 Prozent der 10- bis 19-Jährigen In-Game-Käufe tätigen – ein Indikator für die ökonomische Relevanz und das Risikopotenzial.
Der Werkzeugkasten der Regulierung: Drei Ansatzpunkte
Mecklenburg-Vorpommern kündigt eine Bundesratsinitiative für Ende September an. Der Entwurf sieht drei zentrale Instrumente vor:
- Transparenzpflichten: Anbieter sollen die Inhalte und Gewinnwahrscheinlichkeiten von Lootboxen klar, verständlich und vor dem Kauf offenlegen.
- Warnhinweise: Verbindliche Hinweise zu Glücksspiel-Gefahren, analog zu regulatorischen Vorgaben in der Lotto-Werbung.
- Medienbildung: Verankerung der Themen Lootboxen und Pay-2-Win-Mechanismen in Lehrplänen, um Kompetenzen im Umgang mit Zufallsmechaniken und monetären Anreizen zu fördern.
Europa schaut hin: Verbot und Verschärfungen im Ausland
Der Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass Regulierung kein isoliertes Anliegen ist. In Belgien sind Lootboxen bereits verboten. In Niederlande und Spanien werden strengere Verbraucherschutzvorgaben diskutiert.
Auch die Europäische Kommission spricht sich dafür aus, Minderjährige besser vor kostenpflichtigen Lootboxen und ähnlichen Glücksspiel-Mechanismen zu schützen. Der Vorstoß aus Mecklenburg-Vorpommern reiht sich damit in eine breitere europäische Debatte ein.
Prävention und Hilfe: Infrastruktur im Land Mecklenburg-Vorpommern
Über reines Ordnungsrecht hinaus verweist Drese auf die bestehenden Unterstützungsangebote. Die Suchtberatungsstellen im Land und die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (LAKOST) sind erste Anlaufstellen für Betroffene.
Die Bekämpfung der Glücksspielsucht ist dort Schwerpunkt, Schulungen und Workshops für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sollen Wissenslücken schließen und Handlungssicherheit schaffen. Prävention wird damit als kontinuierliche Aufgabe verstanden – ergänzend zu Transparenz und Aufklärung.
Dialogorientierter Prozess: Regulieren mit Augenmaß
Die Ministerin setzt auf Austausch statt auf Konfrontation. Sie kündigt an, mit allen Beteiligten den Austausch zu suchen, um tragfähige, praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Ziel sei es, Minderjährige wirksam zu schützen, ohne den Spielspaß pauschal zu beschneiden:
„Mein Ziel ist es, gemeinsam mit der Branche, der Politik und den Familien verantwortungsvolle Lösungen zu finden, die den Spielspaß erhalten, aber Kinder und Jugendliche wirksam vor den Risiken schützen.“
Der politische Prozess bleibt damit offen für branchenspezifische Besonderheiten – und fokussiert zugleich auf die Reduktion von Glücksspiel-ähnlichen Risiken.
Mit der angekündigten Bundesratsinitiative will Mecklenburg-Vorpommern die Debatte auf Bundesebene strukturieren. Transparenz, Warnhinweise und Medienbildung bilden das Kernpaket.
Ob und in welcher Form der Bundesrat die Vorschläge aufgreift, wird den weiteren Kurs bestimmen. Klar ist: Der Schutz Minderjähriger vor Glücksspiel-Mechanismen im Gaming dürfte in den kommenden Monaten an politischem Gewicht gewinnen.
Quelle & Bildquelle: Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport